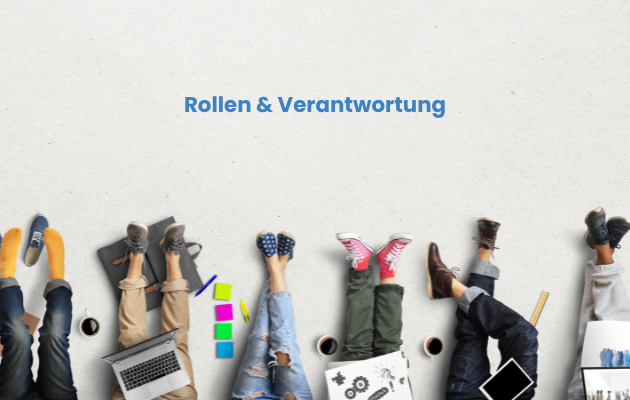
Selbstorganisation braucht klare Rollen – warum Strukturen Freiheit ermöglichen
Selbstorganisierte Teams gelten als flexibel, effizient und zukunftsfähig – doch in der Praxis erleben viele etwas anderes: Missverständnisse, Unsicherheit, Rollenunklarheit. Die Idee, „dass alle alles ganz flexibel machen können“, klingt verlockend – führt aber oft ins Chaos.
Was viele unterschätzen: Selbstorganisation funktioniert nur dann gut, wenn sie auf klaren Rollen basiert. Rollen sind keine starren Positionen – sie sind lebendige Vereinbarungen über Verantwortung, Beitrag und Entscheidungsräume.
In diesem Beitrag zeige ich, warum definierte Rollen die Basis gesunder Selbstorganisation sind, welche psychologischen Effekte sie im Team auslösen – und wie Teamcoaching helfen kann, Klarheit zu schaffen.
Selbstorganisation ≠ Strukturfreiheit
Der größte Irrtum über Selbstorganisation ist: „Da regelt sich alles von selbst.“
In der Realität entsteht schnell Unklarheit:
-
Wer entscheidet was?
-
Wer ist wofür ansprechbar?
-
Wo endet meine Verantwortung – und wo beginnt die der anderen?
Ohne klare Antworten auf diese Fragen entsteht Verantwortungsdiffusion – Aufgaben bleiben liegen, Spannungen steigen, Eigeninitiative sinkt.
Beispiel aus dem Coaching:
Ein Team hatte sich auf flache Hierarchien und die Abschaffung einer Leitungsebene umgestellt, alle sollten „gleichberechtigt mitgestalten“. In der Praxis übernahmen einzelne viel zu viel, andere zogen sich zurück. Es entstanden Spannungen und Konflikte. Erst als das Team gemeinsam Rollen definierte – mit Verantwortungsbereichen, Entscheidungsbefugnissen und klaren Kommunikationswegen – kam wieder Bewegung in die Zusammenarbeit. Was sollte zudem mit den ehemaligen Team-Leitungen passieren? Einige fanden die Idee sehr gut und trugen sie mit. Andere waren überhaupt nicht begeistert und blockierten den Prozess, da sie auf ihre Position verzichten und in eine andere Rolle wechseln sollten.
Warum klare Rollen psychologische Sicherheit schaffen
Definierte Rollen geben Orientierung. Sie schaffen Sicherheit, weil Menschen wissen, woran sie sind – was von ihnen erwartet wird, was sie erwarten dürfen und wie sie sich ins Team einbringen können.
Psychologisch betrachtet fördern Rollen:
-
Zugehörigkeit: Ich weiß, wo mein Platz ist.
-
Selbstwirksamkeit: Ich kann Verantwortung übernehmen – ohne mich zu überfordern.
-
Vertrauen: Ich sehe, was andere beitragen – und dass wir uns aufeinander verlassen können.
Rollen helfen auch, Feedback besser einzuordnen. Rückmeldungen wirken weniger persönlich, wenn sie sich auf eine klar umrissene Rolle beziehen statt auf „den ganzen Menschen“.
Rollen im Team: dynamisch statt statisch
Wichtig: Rollen sollten nicht als Titel oder Jobbeschreibungen verstanden werden. Eine gute Rollendefinition beantwortet:
-
Was ist der Beitrag dieser Rolle zum Teamerfolg?
-
Welche Verantwortungsbereiche und Entscheidungsspielräume umfasst sie?
-
Welche Erwartungen sind damit verbunden?
-
Welche Schnittstellen gibt es zu anderen Rollen?
Und: Rollen dürfen sich verändern. In agilen Teams werden Rollen regelmäßig reflektiert, angepasst und neu verteilt – je nach Phase, Projekt oder Entwicklung.
Selbstorganisation und Rangdynamik: Klarheit entlastet
In vielen Teams wirkt unter der Oberfläche das rangdynamische Modell nach Raoul Schindler: Alpha, Beta, Gamma, Omega – also Führende, Beratende, Mitlaufende, Herausforderer.
Ohne definierte funktionale Rollen „sortieren“ sich Teams oft unbewusst – auf Basis von Lautstärke, Durchsetzung oder Sympathie. Das kann zu Spannungen und verdeckten Machtkonflikten führen.
Klare, bewusst verteilte Rollen schaffen hier Transparenz und Gleichgewicht. Sie helfen, Verantwortung sichtbar zu machen – und Last gleichmäßiger zu verteilen.
Wie Teamcoaching bei der Rollenfindung unterstützt
Ein gutes Teamcoaching bietet Raum für genau diese Fragen:
-
Welche Rollen gibt es im Team – offiziell und informell?
-
Welche Aufgaben sind aktuell nicht klar zugeordnet?
-
Wo gibt es Überlastung oder blinde Flecken?
-
Wie können wir Rollen gemeinsam definieren, prüfen und weiterentwickeln?
Dabei geht es nicht um Hierarchie oder Kontrolle – sondern um Gestaltungsfreiheit durch Struktur.
Coachingformate, die sich bewährt haben:
-
Rollenworkshops (z. B. mit Responsibility Maps oder Delegation Poker)
-
Retrospektiven
-
Teamreflexion anhand realer Projekte oder Konflikte
-
Arbeit mit gruppendynamischen Modellen als Entwicklungsrahmen
-
Kombination mit Führungskräfte-Coaching zur bewussten Rollenklärung
Kurz gesagt: Klare Rollen sind das Fundament für echte Selbstorganisation
Wer Selbstorganisation im Team fördern will, darf Rollen in der Struktur nicht unterschätzen. Freiheit entsteht nicht im luftleeren Raum – sie braucht Orientierung, einen Rahmen, Verbindlichkeit und die Möglichkeit, Verantwortung bewusst zu übernehmen.
Definierte Rollen geben Teams Sicherheit, Klarheit – und die Freiheit, wirklich gemeinsam zu gestalten.
Sie möchten Selbstorganisation und Rollenklarheit in Ihrem Team stärken?
Ich begleite Sie mit Teamcoaching, das Struktur schafft, Verantwortung klärt und Zusammenarbeit nachhaltig verbessert – mit psychologischem Fundament und Feingefühl, erlebnisorientierten Tools und Raum für echte Entwicklung.
👉 in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch gebe ich gerne mehr Einblicke zu unserer Coachingausbildung.

